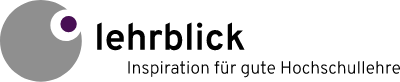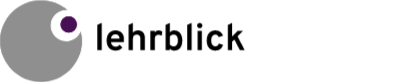Der Podcast “Gasthörer” mit Forschenden der Universität Regensburg, die Wissenschaftsshow MAITHINK X mit Mai Thi Nguyen-Kim, das Bühnenprogramm der Science Busters: drei Beispiele gelungener externer Wissenschaftskommunikation. Damit ist die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte an ein nicht-wissenschaftliches Publikum gemeint. Die Herausforderung dabei: Komplexe Forschungsergebnisse müssen verständlich und ansprechend dargestellt werden. Wissenschaftskommunikation umfasst aber nicht nur die reine Weitergabe von Informationen, sondern zielt auch auf den Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft. Was die drei Beispiele ebenfalls zeigen: Die Zielgruppen sind äußerst vielfältig (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2019).
Die Wissenschaft hat gegenüber der Gesellschaft eine Verantwortung.
Wissenschaftskommunikation ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Verpflichtung von Wissenschaft (Bertemes, 2024; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen in der Verantwortung, evidenzbasierte Antworten zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen und Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Probleme zu liefern. Damit helfen sie Bürgerinnen und Bürgern, informierte Entscheidungen zu treffen – auch bei politischen Fragen. Die Bevölkerung traut der Wissenschaft diese Rolle auch explizit zu. In der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsbarometers (Wissenschaft im Dialog, 2024) gaben 55 % der Befragten an, Wissenschaft und Forschung “voll und ganz” bzw. “eher” zu vertrauen, und zwar vor allem, weil die Forschenden als Experten in ihrem Feld wahrgenommen werden (Zustimmung: 67% der Befragten). Dabei geht es nicht nur darum, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verbreiten, sondern auch das Verständnis für wissenschaftliche Methoden und mögliche Unsicherheiten in den kommunizierten Ergebnissen zu stärken.
Ein weiterer Grund für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, ist der Dialog mit Nicht-Fachleuten. Dieser Austausch fördert das gegenseitige Verständnis und kann – wenn er transparent und offen geführt wird – damit sowohl das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft stärken als auch dabei helfen, Diskussionen auf eine sachliche Grundlage zu stellen (Bertemes, 2024). Ein Mehrwert für die Forschenden liegt darin, Rückmeldungen und Wertschätzung für ihre Arbeit zu bekommen (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). Das kann sogar so weit gehen, dass Bürgerinnen und Bürger an der eigenen Forschung beteiligt werden (“Bürgerforschung”, s.u.).
Diese Verantwortung wird umso dringlicher angesichts der aktuellen Herausforderungen, vor denen die Wissenschaftskommunikation steht: (1) Aktiv gegen falsche Behauptungen vorzugehen, die sich im Internet rasend schnell verbreiten, und mit wissenschaftlich fundierten Inhalten dagegenzuhalten. (2) Innovative Wege der Vermittlung zu entwickeln, um Wissenschaft nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern.
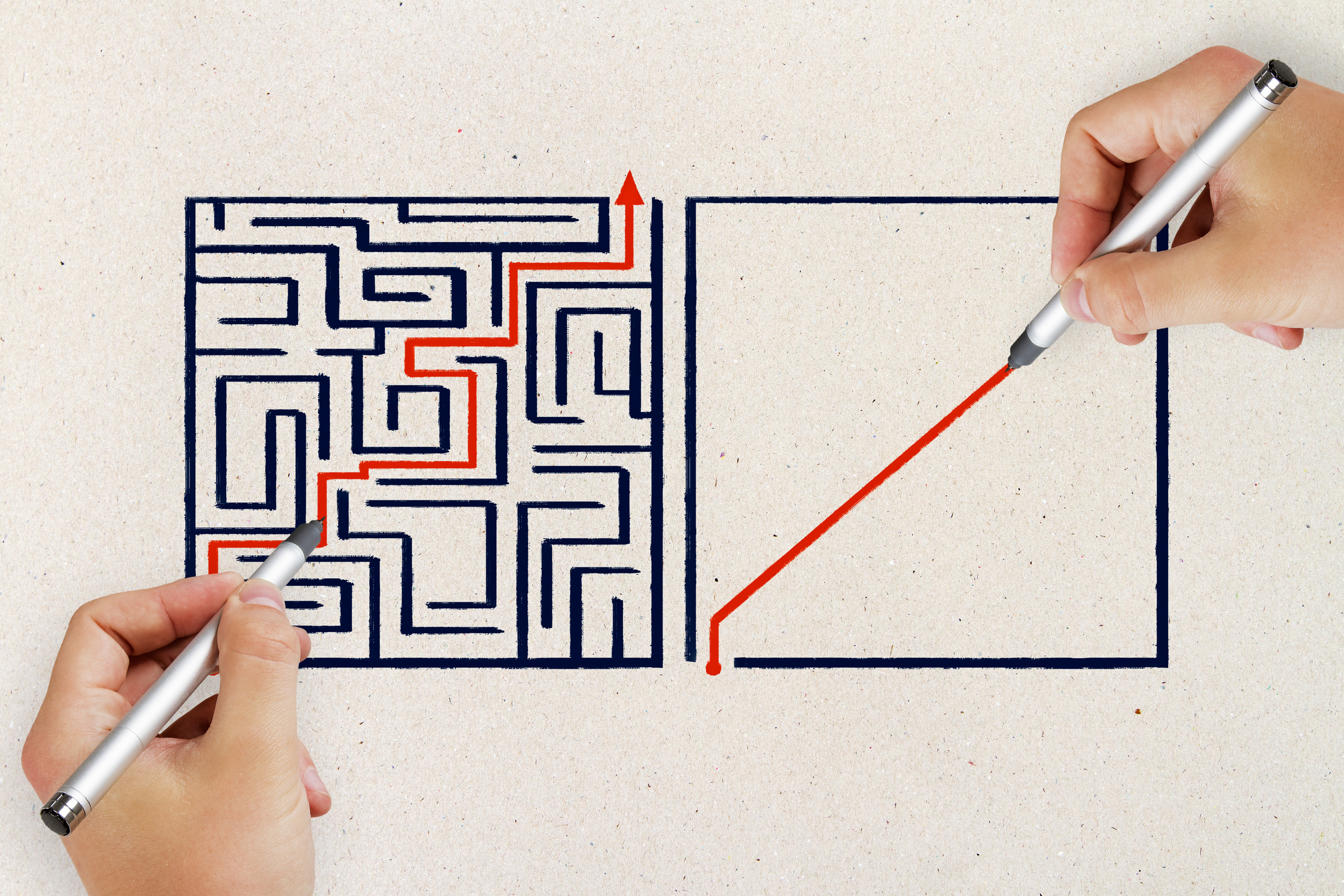
Die Öffentlichkeit denkt anders als Ihre Fachkolleg:innen.
Wissenschaftskommunikation ist kein Hexenwerk, aber auch kein Selbstläufer. Mit einem Fachartikel oder Fachvortrag richten Sie sich an eine recht gut definierte Gruppe: eine mit Wissenschaft und deren inhärenten Eigenschaften sowie der Fachsprache vertraute, homogene Leserschaft mit entsprechendem Vorwissen. Bei einem Fachartikel ist der wissenschaftliche Diskurs explizit mitangelegt, für die Leserinnen und Leser sind komplexe, sich widersprechende Interpretationen und Behauptungen nichts Ungewöhnliches.
Davon unterscheidet sich die Zielgruppe derer, die Sie durch Wissenschaftskommunikation erreichen möchten, deutlich! Es sind sehr unterschiedliche Kontexte auf Empfängerseite vorhanden, z. B. sind das Vorwissen und die Zielgruppen sehr heterogen. Auch sind die Empfänger potentiell mehr oder weniger skeptisch gegenüber wissenschaftlichen Informationen und können mit dem Gedanken der Unsicherheit und dem Widerspruch besser oder schlechter umgehen. Das macht Wissenschaftskommunikation aufwändig. Es gibt kein “one size fits all” (Haan, 2024). Die gute Nachricht: Es gibt zwei grundlegende Prinzipien, deren Berücksichtigung Ihnen die Kommunikation und den Austausch erleichtert. Achten Sie auf Dialogorientierung (Förderung des Austauschs mit dem Publikum und Einbezug von dessen Rückmeldungen in die eigene wissenschaftliche Arbeit) und Transparenz, also die Offenlegung von Methoden, Unsicherheiten und möglichen Interessenkonflikten (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2019).
Gute Wissenschaftskommunikation ist machbar.
Beachten Sie in der Kommunikation mit einer nicht-wissenschaftlichen Zielgruppe die folgenden zwei Empfehlungen. (1) Reduzieren Sie die Komplexität des zu vermittelnden Inhalts ohne zu vereinfachen. Wissenschaftliche Erkenntnisse beruhen oft auf jahrelanger Forschung, komplexen Methoden und differenzierten Ergebnissen. Die Kunst besteht darin, diese so zu vereinfachen, dass sie verständlich werden, ohne inhaltlich falsch zu sein. (2) Verwenden Sie eine klare und eindeutige, an der Zielgruppe orientierte Sprache: Formulieren Sie dazu kurze Sätze und verringern Sie die Informationsdichte in Ihren Texten. Wissenschaftliche Fachsprache ist präzise, aber für Laien oft schwer verständlich. Verzichten Sie, wenn möglich, auf Fachbegriffe oder erklären Sie diese sorgfältig. Bedenken Sie, dass Begriffe unterschiedlich verstanden werden können. So bedeutet der Begriff „Theorie“ im Alltag etwas anderes als im wissenschaftlichen Kontext (Weber, 2024).
Zwei Konzepte, die aus der Lehre bekannt sind, verdienen auch in der externen Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse, Prozesse und Methoden besondere Beachtung: Storytelling und Visualisierungen. Storytelling hat sich als wirksames Instrument erwiesen, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in eine verständliche und ansprechende Erzählung einzubetten. Das macht sie greifbar und schafft persönliche Anknüpfungspunkte (Hans, 2024; Raabe, 2018). Visualisierungen (z.B. Diagramme, Karten oder Simulationen) spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in der Wissenschaftskommunikation. Gut durchdachte Grafiken verdeutlichen komplexe Zusammenhänge auf einen Blick und erleichtern dadurch das Verständnis. Neben diesen grundlegenden Prinzipien müssen in jedem Einzelfall Entscheidungen zu den fünf zentralen Faktoren der Wissenschaftskommunikation – Thema, Zielgruppe, Ziel, Medium/Format und Stil – getroffen werden (“NaWik-Pfeil”; Brandt-Bohne, 2021). Das folgende Video mit Mai Thi Nguyen-Kim erläutert diese Dimensionen anschaulich:
Wissenschaftskommunikation kennt viele Wege.
Es gibt eine Vielzahl von Kanälen und Formaten für die Wissenschaftskommunikation. Für welches Format bzw. welchen Kommunikationskanal man sich letztendlich entscheidet, hängt von der Zielgruppe, dem Thema und den Zielen ab. So erreichen z.B. klassische Formate wie Wissenschaftsmagazine ein anderes Publikum als Social-Media-Kanäle. Podcasts eignen sich besonders für tiefergehende Erklärungen, während kurze Videos auf TikTok oder Instagram jüngere Zielgruppen ansprechen. Im Folgenden stellen wir die gängigsten Formate vor (Dernbach, Kleinert & Münder, 2012; Wissenschaftskommunikation, o. D.).
- Traditionelle Medien: Wissenschaftsthemen werden seit Jahrzehnten in Zeitungen und Zeitschriften (oft in Form eines eigenen Wissenschaftsteils) sowie in Wissenschaftssendungen in Radio und Fernsehen verbreitet. Sie erreichen ein breites Publikum und eignen sich gut zur Vermittlung von Forschungsergebnissen an die Allgemeinheit.
- Digitale Medien: Blogs, Podcasts und Social-Media-Plattformen (u.a. YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, LinkedIn) ermöglichen eine direkte Ansprache spezifischer Zielgruppen und bieten interaktive Formate. Blogs werden eher von einer kleineren, interessierten Gruppe gelesen und von denjenigen, die mittels Suchmaschinen auf der Suche nach Informationen darauf stoßen. Soziale Netzwerke ermöglichen Partizipation (u.a. durch die “Kommentar”-Funktion) und die schnelle Weiterverbreitung wissenschaftlicher Informationen mittels der “Teilen”-Funktion.
- Veranstaltungen: Bekannte Formate wie Wissenschaftsfestivals, Vorträge, Workshops und “Lange Nacht der Wissenschaften”, aber auch innovative Formate wie Science Slams oder Wissenschaftstheater bieten die Möglichkeit zum direkten Austausch zwischen den Forschenden und der Öffentlichkeit.
- Reale Orte: Reale Orte sind Begegnungsräume, in “denen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger über Chancen und Herausforderungen wissenschaftlicher Entwicklungen diskutieren und Ideen zur Gestaltung der Zukunft entwickeln können” (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2019, S. 4). Bekannte Einrichtungen sind die Leibniz-Forschungsmuseen, das Futurium, Wissenschaftsläden und Häuser der Wissenschaft.
- Bürgerforschung: Hierbei handelt es sich um Projekte, bei denen Bürgerinnen und Bürger aktiv in Forschungsprozesse eingebunden werden, wie z.B. dem Tagfalter-Monitoring. Diese Projekte fördern das Verständnis für wissenschaftliche Methoden und stärken die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
Auf dem Portal Wissenschaftskommunikation.de finden Sie eine Datenbank mit mehr als 110 Einträgen, in der Sie nach Zielgruppe und Formatart gezielt nach geeigneten Formaten für Ihr konkretes Kommunikationsprojekt suchen können. Dort sind sowohl bekannte als auch innovative Formate von A wie “Adults-only-Science-Night” bis Y wie “YouTube” enthalten. Für jedes Format gibt es ausführliche Hinweise zur Umsetzung, konkrete Umsetzungsbeispiele sowie weiterführende Informationen.
Mit welchem Format haben Sie bereits gute Erfahrungen gemacht? Was hat nicht so gut funktioniert? Teilen Sie Ihre Erfahrungen über unseren LinkedIn-Kanal.
Literatur
Bertemes, J.-P. (2024). Science with and for society. In J.-P. Bertemes, S. Haan & D. Hans (Hrsg.), 50 essentials on science communication (S. 14–15). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110763577
Brandt-Bohne, U. (2021, 25. Mai). Die zentralen fünf Dimensionen der Wissenschaftskommunikation. https://www.wissenschaftskommunikation.de/die-zentralen-fuenf-dimensionen-der-wissenschaftskommunikation-48385/
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019). Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Wissenschaftskommunikation. https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/1/24784_Grundsatzpapier_zur_Wissenschaftskommunikation.pdf?__blob=publicationFile&v=5
Dernbach, B., Kleinert, C., & Münder, H. (Hrsg.). (2012). Handbuch Wissenschaftskommunikation. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18927-7
Haan, S. (2024). Target groups of science communication. In J.-P. Bertemes, S. Haan & D. Hans (Hrsg.), 50 essentials on science communication (S. 40–41). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110763577
Hans, D. (2024). Ingredients of a good story. In J.-P. Bertemes, S. Haan & D. Hans (Hrsg.), 50 essentials on science communication (S. 58–59). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110763577
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017). Communicating Science Effectively: A Research Agenda. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/23674
Raabe, K. (2018, 6. August). Forscher auf der Heldenreise – Wissenschaft spannend erzählen. Wissenschaftskommunikation.de. https://www.wissenschaftskommunikation.de/forscher-auf-der-heldenreise-wissenschaft-spannend-erzaehlen-16995/
Weber, M. (2024). Language and simplification. In J.-P. Bertemes, S. Haan & D. Hans (Hrsg.), 50 essentials on science communication (S. 60–61). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110763577
Wissenschaft im Dialog (2024). Wissenschaftsbarometer 2024. https://wissenschaft-im-dialog.de/documents/332/2024_Wissenschaftsbarometer_Broschuere_web.pdf
Wissenschaftskommunikation. (o. D.). In Wikipedia. Abgerufen am 12. Juni 2025, von https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftskommunikation
Vorschlag zur Zitation des Blogbeitrags
Bachmaier, R. (2025, 19. Juni). Wissenschaftskommunikation: Verbindung zwischen Forschung und Gesellschaft. Lehrblick – ZHW Uni Regensburg. https://doi.org/10.5283/ZHW.20250619.DE

Regine Bachmaier
Dr. Regine Bachmaier ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. Sie unterstützt die Lehrenden im Bereich "Digitale Lehre", u.a. durch Workshops sowie individuelle Beratung. Daneben versucht sie, den Überblick über Aktuelles aus dem Bereich "Digitale Lehre" zu behalten und weiterzugeben.
- Regine Bachmaier