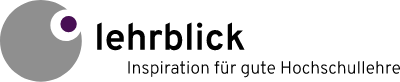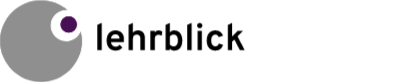Lernmythen sind weit verbreitet. Viele von uns haben schon mal Gehirnjogging betrieben oder Hoffnung in den Verzehr von Studentenfutter gesetzt. Der vorliegende Beitrag behandelt drei Mythen, die Defizite auf Seiten der Lernenden postulieren und so schnell zu didaktischen Sackgassen werden können: Verdummung, Hirnhälftendominanz und Aufmerksamkeitsschwäche.
Mythos 1: Die Studierenden werden immer dümmer
Lehrperson zu sein ist kein leichtes Brot. Bereits 3000 Jahre vor Christus hielten frustrierte Sumerer ihren Unmut über die Jugend auf Tontafeln fest: Diese achte das Alter nicht mehr, sinne nach Umsturz und habe keine Lernbereitschaft. In den seither vergangenen 5000 Jahren hat sich an dieser Einschätzung wenig geändert (Gilfert, 2015). Insbesondere Lehrende, die bereits einige Jahre an Lehrerfahrung mitbringen, sind oft der festen Überzeugung, dass in ihrer eigenen Jugend die Studierenden noch lernwilliger waren als heute. Was früher selbstverständlich war, ist es heute nicht mehr. Und obendrauf kommt noch die vermeintlich faule Generation Z.
Evidenz: Zwar ist Dummheit bis heute noch kein Gegenstand der Wissenschaft geworden, aber über ihr Gegenteil, die Intelligenz, hat die Psychologie in den letzten 130 Jahren ausgiebig geforscht und dabei tatsächlich Veränderungen zwischen den Generationen festgestellt. Nur nicht in die erwartete Richtung: Der sogenannte Flynn-Effekt zeigt, dass in den westlichen Industrienationen bis in die 90er Jahre der durchschnittliche Intelligenzquotient stetig zunahm. Seitdem stagniert der Wert weitgehend, wobei einige Studien auch leichte Abnahmen zeigen. Eine Metastudie mit Intelligenzdaten der letzten 100 Jahre (Pietschnig & Voracek, 2015) bestätigt eine abgeschwächte Zunahme der Intelligenz in den letzten drei Jahrzehnten. Die Ursachen für Anstieg, Stagnation und Abnahmen sind wissenschaftlich noch nicht geklärt.
Für eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit existieren zahlreiche Wörter wie Trottel, Dummkopf oder Idiot. Die Etymologie des altgriechischen idiotes eröffnet einen interessanten Zugang zum Problem: Ein Idiot ist jemand, der mangels Beschulung keinen Zugang zum Allgemeinwissen hat. Dies lässt sich auf das heutige Klagen vieler, zumeist älterer Lehrenden anwenden: Die Studierenden wissen immer weniger von dem, was die Lehrenden für sich als Allgemeinwissen erachten. Nun bringt uns das zum zentralen Problem, warum wir manche Dinge nur durch Begleitung einer Lehrperson und nicht durch das Lesen eines Buches lernen können: Lernen wird dort schwer, wo es bisherige Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Zum Beispiel, dass uns die Erde, auf der wir stehen, im Alltag wie eine Fläche und nicht wie eine Kugel erscheint. Und dieses Problem der vermeintlichen Selbstverständlichkeit gilt nicht nur für das Lernen, sondern auch für das Lehren: Wer als Expert:in bereits viel Erfahrung mit dem eigenen Fach gesammelt hat, verfügt über eine deutlich größere Menge an fachbezogenen Selbstverständlichkeiten. Das ist für die Lehre jedoch eher ungut, denn Selbstverständlichkeiten haben die schlechte Angewohnheit, dass wir sie oft nicht gut erklären können – und es in unseren Augen auch nicht müssen, da sie ja selbstverständlich sind. Entsprechend scheitern Expert:innen häufig daran, ihren Lernenden vermeintlich einfachste Dinge zu erklären und führen dies dann zu Unrecht häufig allein auf immer geringer werdende geistige Fähigkeiten der Lernenden zurück.
Möglicherweise würde der akademischen Welt eine Revision des Kampfbegriffs „dumm“ guttun, denn manchmal sind scheinbar „dumme“ Fragen sogar ein wichtiger Weg zum wissenschaftlichen Fortschritt, den etablierte Expert:innen durch ihre festgefahrene Sichtweise auf die Dinge nicht mehr sehen können oder wollen.

Mythos 2: Für jede:n nur eine Hirnhälfte
Das Gehirn gilt als kompliziertestes Objekt im Universum und doch benutzen wir es jeden Tag mal mehr und mal weniger zielführend. Ein erfolgreiches Leben wird oft direkt mit der Fähigkeit verbunden, das eigene möglichst effizient zu nutzen. Entsprechend frustrierend ist es für viele leistungsorientierte Lernende zu hören, dass sie vermeintlich nur eine der beiden Hälften ihres Gehirns nutzen und deshalb eben nur bestimmte Dinge gut können und andere Dinge nicht, da ihnen hierfür schlicht die passende benutzbare Hirnhälfte fehlt. Männer dürfen übrigens nur die linke, rational-analytische Hirnhälfte benutzen und Frauen die rechte, emotional-kreative Hirnhälfte. Clevere Neuro-Coaches haben vermeintlich wissenschaftliche Techniken entwickelt, um beide Hirnhälften durch Bewegungsgymnastik und Logik-Rätsel miteinander zu synchronisieren und so für eine vergleichsweise geringe Gebühr unsere Hirnleistung faktisch zu verdoppeln. Seit Anfang der 2000er Jahre ist Gehirnjogging trotz fehlender stützender wissenschaftlicher Befunde zu einem riesigen Markt geworden – nicht zuletzt aus der Angst älterer Menschen heraus, beruflich abgehängt zu werden oder der Demenz anheim zu fallen.
Hinter dem Mythos der steigerbaren Hirnleistung steht der Meta-Mythos: „Das Gehirn ist ein Computer“und analog zur technischen Speicherlösung existiert für jede kognitive Funktion ein eigener räumlicher Bereich. Allerdings zeigt die empirische Hirnforschung, dass an so gut wie allen mentalen Prozessen zahlreiche Orte im Gehirn gemeinsam beteiligt sind und sogar nicht nur auf einer, sondern auf beiden Hirnhälften, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Hierbei von einem Meta-Mythos zu sprechen, macht deshalb Sinn, da dieser Mythos sich über alle Bereiche unseres Privat- und Berufslebens erstreckt und genau wie alle „normalen“ Mythen folgende Aussage transportiert: Die Welt folgt einer für uns alltäglichen, intuitiven Ordnung.
Evidenz: Das Gehirn ist im Gegensatz zu Augen, Lungen und Nieren kein perfekt symmetrisches Organ. In den 1960er Jahren wurde bei Patienten mit schwerer Epilepsie die Verbindung zwischen beiden Hirnhälften durchtrennt. Psychologische Untersuchungen dieser Split-Brain-Patienten zeigen unterschiedliche Verarbeitung von Informationen in den getrennten Hirnhälften (Sperry, 1961). Die Zuordnung bestimmter Aufgaben zu der einen oder anderen Hirnhälfte ist jedoch nicht genetisch festgelegt. Vielmehr kann eine Hirnhälfte auch im hohen Alter noch lernen, was bisher nur in der anderen Hirnhälfte ablief – beispielsweise nach einem Schlaganfall, bei dem Teile des Gehirns zerstört wurden. In unserem Alltag arbeiten beide Hirnhälften dankbarerweise sehr intensiv miteinander und lassen sich hiervon auch nicht durch Mythen oder vermeintliche Gehirntrainings abbringen.
Wenn Lernende sich im Sinne des Mythos als 50%-Invaliden betrachten, hat dies vermutlich nicht nur Auswirkungen auf ihr Selbstbild („Wenn ich Zahlen/Emotionen/Kunstwerke/Formeln sehe, bekomme ich einen Blackout!“) sondern auch auf die Wahl ihrer Lernstrategien. Ähnlich wie beim Mythos vom visuellen, akustischen und haptischen Lerntyp dürfte auch hier der Glauben an den Mythos zu einem Self-Handicapping der Lernenden führen, indem sie bestimmte Lerntätigkeiten kategorisch ausschließen und sich so effektiv selbst sabotieren.
Fazit: Unser Gehirn ist kein Gefäß, kein Computer und erst recht kein Muskel. Entsprechend profitiert es nicht nur wenig von einer möglichst hohen Zahl gleichartiger, monotoner Wiederholungen bei Gehirngymnastik und Gehirnjogging, sondern vielmehr von neuartigen und abwechslungsreichen Herausforderungen. Deshalb sollten wir auch von der Devise „no pain, no gain“ Abstand nehmen, da Kopfschmerzen ziemlich sicher kein Anzeichen für erfolgreiches Lernen sind. Stattdessen unterstützt uns unser von Natur aus neugieriges Gehirn sogar freiwillig beim Lernen, indem es Glückshormone produziert, wenn wir Probleme erfolgreich lösen oder von uns getroffene Vorhersagen sich bewahrheiten. Manche Menschen denken zudem lieber kreativ, andere eher analytisch. Der Grund dafür liegt aber nicht in unserer Genetik, sondern in unserer Sozialisation und nicht zuletzt auch in unserem Selbstbild als eher kreativ oder analytisch begabter Mensch, wobei die beiden Begabungen sich nicht gegenseitig ausschließen müssen.

Mythos 3: Alle 10-15 Minuten ein Methodenwechsel
Jungen Menschen wird nachgesagt, sie haben eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch (angeblich neun Sekunden). Die psychologische Forschung scheint dies zu bestätigen, indem sie zeigt, dass die Aufmerksamkeitsspanne junger Menschen seit 2012 kontinuierlich abnimmt (APA, 2023) . Was liegt hier näher, als auf Mythos 1 zurückzugreifen und zu konstatieren, dass die Jugend durch exzessiven Medienkonsum degeneriert und wir als Lehrende deshalb unseren Unterricht verstärkt auf die magischen 15 Minuten Aufmerksamkeitsspanne ausrichten müssen. Was dabei gerne übersehen wird, ist (1) wie häufig wir unsere Aufmerksamkeit ohne Probleme und Methodenwechsel teils über Stunden aufrechterhalten können und (2) wie stark sich die Welt um uns herum seit der Einführung der ersten Fernseher und Leuchtreklamen verändert hat. Vermutlich ist es eher andersherum, nämlich dass die Welt immer besser darauf ausgelegt ist, uns abzulenken.
Der Weg zum Status Quo: Die Welt spricht uns an. Nicht nur Kunstwerke, sondern auch Alltagsgegenstände rufen uns förmlich zu „Beschäftige dich mit mir!“. Diese teils sirenenartige Ansprache wird meist als Affordanz oder Aufforderungscharakter (Gibson, 1982) bezeichnet und spielt unter anderem in der Usability-Forschung eine große Rolle. Je mehr nun Wissenschaften wie die Psychologie über die Mechanismen der Aufmerksamkeit herausfinden, desto aufmerksamkeits-haschender können Zeitungen, Online-Plattformen und nicht zuletzt Werbetreibende ihre verlockenden Angebote gestalten.
Fehlende Evidenz: In seiner Analyse des 15-Minuten-Mythos der Aufmerksamkeit betreibt Neil Bradbury (2016) Mythen-Ahnenforschung entlang einer fast 40 Jahre andauernden Zitationskette und kann so die „magischen 10-15 Minuten“ auf eine Studie von 1978 (Hartley & Davies, 1978) zurückführen. Die Autoren untersuchten, wie sich die Menge der angefertigten Mitschrift-Notizen im Verlauf einer Vorlesung ändert. Nach 10 bis 15 Minuten wurde eine Abnahme der Notizen festgestellt. Die Autoren selbst merken in mehreren Publikationen an, dass diese eine Vorlesung nicht repräsentativ und das Machen von Notizen zudem kein Indikator für die Aufmerksamkeit sei. Außer dieser Studie gibt es keine weitere empirische Evidenz, auf die sich der Mythos stützt. Für die Popkultur und die Medien scheinen die 15 Minuten hingegen eine wunderbare Zahl zu sein, da Andy Warhol im Jahr 1968 medienwirksam verkündete “In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.”
Fazit: Zahlen haben etwas Magisches und wo Magie ist, sind auch Mythen nicht weit. Genauso wie der Mythos, dass wir nur 10 % unseres Gehirns nutzen, stellt sich auch hier schnell die Ernüchterung ein. Unser Gehirn kann nicht wie eine Maschine begriffen werden, die mit etwas Tuning ihre in Zahlen beschreibbare Leistung vervielfacht. Das Gehirn ist durch Evolution zum Tun und nicht als quantitatives Speichermedium gemacht. Langeweile kann als Ausdruck dieser evolutionären Prägung gesehen werden. Die Ursache für die Ablenkbarkeit wird dabei von Lehrpersonen oft ausschließlich zwischen den betroffenen Ohren und nicht in der reizintensiven Umwelt gesucht. Insbesondere Smartphones wirken jedoch wie kleine Alarmmaschinen und beanspruchen permanent unsere Aufmerksamkeit.
Neue Lehrformen wie problembasiertes Lernen und Gamification und auch etablierte Unterrichtsmethoden wie Think-Pair-Share und das Gruppenpuzzle greifen dieses Streben zum Tun auf und fördern so gehirngerechtes Lernen.
Behindern diese Mythen den Lernerfolg?
Mythen werden erst dann zu einer Gefahr für den Lernerfolg, wenn sie Lernende so sehr entmutigen, dass diese ihre Lerntätigkeiten frühzeitig aufgeben und auch nicht wieder anfangen, da sie ja angeblich sowieso das falsche Gehirn für so eine Aufgabe haben. Gleiches gilt für die Seite der Lehrenden: wenn hier der Mythenglauben die letzte Hoffnung daran raubt, dass sich noch ein Erfolg bei den betreffenden Lernenden einstelle, dann werden Lehrende ihre Anstrengungen aufgeben, diese Lernenden zu unterstützen. Sich gegen eine so durch Lehrkräfte attestierte Unfähigkeit zu wehren, gelingt sicher nur den wenigsten Lernenden. So entstehen dann selbsterfüllende Prophezeiungen: „Weil es nicht klappen konnte, habe ich es nicht probiert und somit habe ich gezeigt, dass es nicht geklappt hat!“
In den letzten Jahren zeigt die Forschung zum Mythenglauben erfreulicherweise, dass sich nur ein geringer Bruchteil der zahlreichen und weit verbreiteten Mythen über das Lernen negativ auf den Erfolg von mythengläubigen Lehrenden (Horvath et al., 2018) und Studierenden (Krammer et al., 2021) auswirkt.
Literatur
APA (2023). Speaking of Psychology: Why our attention spans are shrinking. https://www.apa.org/news/podcasts/speaking-of-psychology/attention-spans
Bradbury, N. A. (2016). Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more?. Advances in physiology education, 40(4), 509-513. https://doi.org/10.1152/advan.00109.2016
Gibson, J. J. (1982). Wahrnehmung und Umwelt. Der ökologische Ansatz in der visuellen Wahrnehmung. Urban & Schwarzenberg.
Gilfert. A. (2015). 5000 Jahre Kritik an Jugendlichen – Eine sichere Konstante in Gesellschaft und Arbeitswelt. https://bildungswissenschaftler.de/5000-jahre-kritik-an-jugendlichen-eine-sichere-konstante-in-der-gesellschaft-und-arbeitswelt/
Hartley, J., & Davies, I. K. (1978). Note‐taking: A critical review. Programmed learning and educational technology, 15(3), 207-224. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0033039780150305
Horvath, J. C., Donoghue, G. M., Horton, A. J., Lodge, J. M. & Hattie, J. A. (2018). On the irrelevance of neuromyths to teacher effectiveness: Comparing neuro-literacy levels amongst award-winning and non-award winning teachers. Frontiers in Psychology, 9, 1666. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.01666/pdf
Krammer, G., Vogel, S. E. & Grabner, R. H. (2021). Believing in neuromyths makes neither a bad nor good student‐teacher: The relationship between neuromyths and academic achievement in teacher education. Mind, Brain, and Education, 15(1), 54-60. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/am-pdf/10.1111/mbe.12266
Pietschnig, J. & Voracek, M. (2015). One century of global IQ gains: A formal meta-analysis of the Flynn effect (1909-2013). Perspectives on Psychological Science. https://doi.org/10.2139/ssrn.2404239
Sperry, R. W. (1961). Cerebral Organization and Behavior: The split brain behaves in many respects like two separate brains, providing new research possibilities. Science, 133(3466), 1749-1757.
Vorschlag zur Zitation des Blogbeitrags
Aichele, T. (2025, 15. Mai). Intelligenzverlust, Goldfische und Schieflage im Kopf – Drei Mythen über das Lernen und die Lernenden. Lehrblick – ZHW Uni Regensburg. https://doi.org/10.5283/ZHW.20250515.DE

Thorsten Aichele
Dr. Thorsten Aichele studierte Psychologie und Philosophie und promovierte 2017 im Fach Instruktionspsychologie. Seit 2022 verantwortet er als Teil der Tandem-Leitung das hochschuldidaktische Weiterbildungsprogramm der Universität Würzburg. Er interessiert sich neben didaktischen Mythen auch für Gamification, die Psychologie digitaler Lernmedien, Wissenschaftstheorie und die Nutzbarmachung systemischer Psychotherapietechniken für universitäre Lernsettings.