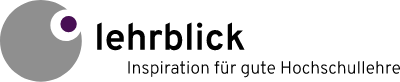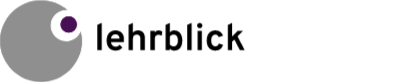Wie könnten zukünftige Szenarien für die Hochschulbildung aussehen? Siân Bayne und Jen Ross haben dieses Gedankenspiel durchgespielt und in ihrem Beitrag “Speculative futures for higher education” (2024) verschiedene mögliche Szenarien entwickelt. Ihr Ziel: Die Szenarien sollen als Provokation bzw. Startpunkt für Gespräche über die Zukunft von Universitäten und Hochschullehre dienen. Zur Entwicklung ihrer Visionen haben Bayne und Ross die datenbasierte Vorgehensweise verlassen und stattdessen spekulative Methoden angewandt.
Szenario 1: Zeitalter der Klimakatastrophe
Die Klimakatastrophe ist weit vorangeschritten. Wasser und Nahrung stehen nicht mehr überall ausreichend zur Verfügung. Menschen müssen ihre Heimat verlassen, es kommt zu massiven Bevölkerungsbewegungen. Es gibt keine nationalen Grenzen mehr. Das Internet darf nur noch für ausgewählte Bereiche von öffentlichem Interesse und nicht mehr von Privatpersonen genutzt werden. Geld existiert nicht mehr. Ressourcen werden umverteilt: Es werden diejenigen belohnt, die sich aktiv für das Überleben der Menschheit und erneuerbare Energien einsetzen.
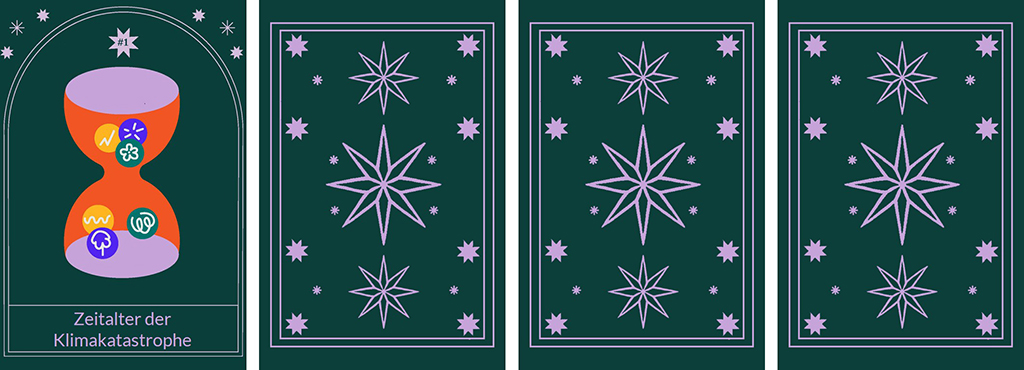
Klingt unwahrscheinlich?
Die globale Oberflächentemperatur lag im Zeitraum 2011–2020 um 1,1°C höher als der Wert von 1850–1900, verursacht v.a. durch die Emission von Treibhausgasen. Dieser vom Menschen verursachte Klimawandel hat bereits zu deutlichen Verlusten und Schäden für Natur und Menschen geführt. Aktuelle Prognosen zur globalen Erwärmung sehen eine weitere Erhöhung der Durchschnittstemperatur um 3,2°C (IPCC, 2023), deren mögliche Folgen Hitzewellen, Starkniederschlagsereignisse, Dürren, Ernteausfälle, Wasserknappheit, soziale Verwerfungen, Krankheiten, Migration, politische Instabilität usw. sind.
Und die Universitäten?
In einer dystopischen Vision wäre Hochschulbildung dringend notwendig, die dafür benötigten Infrastrukturen und Institutionen können allerdings nicht mehr aufrechterhalten werden.
Ein alternatives Szenario sieht einen positiven Wandel in der Hochschulbildung: Waren Universitäten früher in sich geschlossene, um Fördergelder und Prestige konkurrierende Einrichtungen, so arbeiten sie jetzt hochschul- und länderübergreifend in globalen Forschungsnetzwerken zusammen, um mögliche Lösungen für die Bewältigung der Krise zu finden. Zugleich sind die Universitäten jetzt für alle Menschen offen: Hochschulbildung ist intellektuelles Gemeingut – sowohl durch offene Bildungsnetzwerke als auch lokale Lernkollektive. Damit unterstützen Universitäten das Überleben der Menschen.
Szenario 2: KI-Akademie
Künstliche Intelligenz übernimmt viele akademische Aufgaben. Überwachung ist allgegenwärtig, z.B. werden die Anwesenheit aller Hochschulangehörigen sowie das Engagement und das Verhalten der Studierenden mitprotokolliert. Diese Überwachung wird von den meisten positiv wahrgenommen, da vor allem die Vorteile gesehen werden. Datenschutzrechtliche Probleme werden kaum thematisiert. Für die Studierenden bedeutet das: Die KI wertet eine Vielzahl an personenbezogenen Daten aus und kann damit eine umgehende Kategorisierung ihrer Fähigkeiten vornehmen.
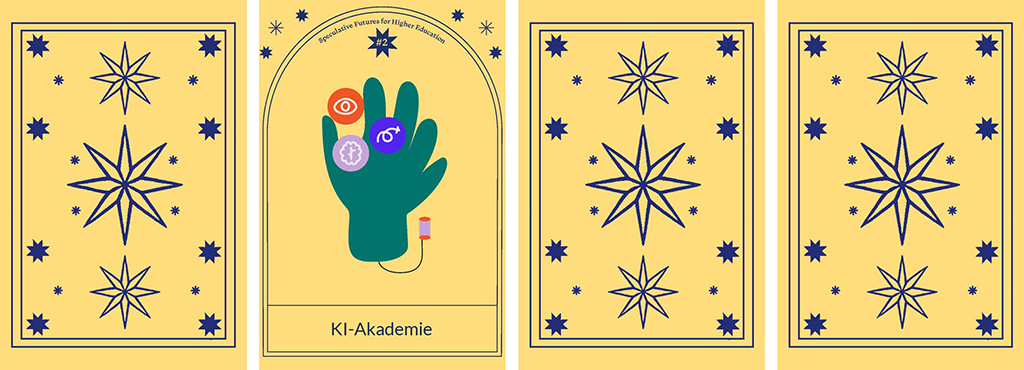
Klingt unwahrscheinlich?
Künstliche Intelligenz ist bereits heute als Schlüsseltechnologie zu sehen. Spätestens Ende 2022 hat die KI mit der Veröffentlichung von ChatGPT nochmals massiv an Dynamik gewonnen. Zu den Chancen der Nutzung von KI in der Hochschullehre zählen u.a. die Personalisierung des Lernens, adaptive Lernumgebungen, intelligente tutorielle Systeme sowie die Unterstützung der Studierenden bei diversen akademischen Aufgaben (von Garrel et al., 2023). Diesen Chancen stehen einige Risiken gegenüber: Es werden umfangreiche Nutzungsdaten gesammelt (hinter denen sich Einseitigkeiten oder Befangenheiten verbergen können), intransparente Algorithmen können zu Verzerrungen (von Daten) führen und ethische Probleme verursachen (Christen et al., 2020; de Witt et al., 2020). Es ist wahrscheinlich, dass zukünftig noch deutlich mehr und auch andere Daten als bisher gesammelt werden, z.B. über eigene Sensoren von Studierenden und Lehrenden sowie Sensoren aus der Umwelt. KI kann damit zur Überwachung, Messung und Bewertung eingesetzt werden.
Und die Universitäten?
Universitäten sind zu Orten ständiger Überwachung geworden. Diese wird von den Hochschulangehörigen akzeptiert, da die Hochschulen ohne diese umfangreichen Informationen über das Verhalten und die Fähigkeiten ihrer Studierenden nicht existieren könnten. Als Risiken werden Ungerechtigkeiten, Ausbeutung und Benachteiligung gesehen. Die Folge: Bereits marginalisierte Gruppen werden ausgeschlossen und jene, die sich aktiv widersetzen, meiden Universitäten.
Dieses Szenario bietet sowohl eine positive als auch negative Fiktion: Der hohe Grad an Personalisierung kann Studierende dabei unterstützen, ihr Wissen vielseitig zu erweitern. Er könnte aber auch zu einer fragmentierten und sehr stark reduzierten Lernerfahrung führen.
Szenario 3: Verbesserte Optimierung
Kognitive und physische Optimierungen sind fester Bestandteil unseres Alltags. Die „Big Pharma“-Industrie und führende Technologiekonzerne verfügen über eine überwältigende Macht, die demokratische Strukturen herausfordert und oft überrollt. Wo früher Ethikkommissionen diskutierten, durchdringen heute Optimierungs-Technologien sämtliche Lebensbereiche. Ob in der Bildung, im Gesundheitswesen oder im Sport – die Optimierung des Menschen ist allgegenwärtig. Mit Hilfe von Smart-Drugs werden Konzentration, Aufmerksamkeit und Wachheit gesteuert. Daten werden aktiv in allen gesellschaftlichen Bereichen gesammelt und genutzt. Gehirndaten – von der Analyse der Konzentrationsfähigkeit bis zur Überwachung emotionaler Zustände – sind zum wertvollsten Rohstoff der Datenindustrie geworden.

Klingt unwahrscheinlich?
Bereits 2025 gehören Pharma- und Technologiekonzerne zu den umsatzstärksten Industrien der Welt. Und sie versuchen mit ihrer wirtschaftlichen Macht auch die soziale und politische Infrastruktur zu beeinflussen. Lobbyisten der Pharmaindustrie wie der Verband der europäischen Pharmaindustrie oder der Bayer-Konzern zählen zu den Organisationen mit den höchsten jährlichen Ausgaben für Lobbyarbeit in der EU (Statista Research Department, 2025). Die Tech-Branche gibt insgesamt jährlich 113 Millionen Euro für Lobbyarbeit in Brüssel aus (Corporate Europe Observatory, 2023). In den USA hat es Elon Musk sogar in den Beraterstab des Präsidenten geschafft.
Und die Universitäten?
Bei diesem Szenario wird der Wandel nirgendwo so deutlich wie an Universitäten. Studierende und Wissenschaftler:innen greifen routinemäßig zu Smart-Drugs und nutzen kognitive Trainings-Apps und elektronische Neurostimulatoren, um die extreme Konzentration und Ausdauer zu erreichen, die für akademische Höchstleistungen notwendig sind. Der Druck ist groß: Leistung, Produktivität und messbare Ergebnisse dominieren die Hochschulkultur. Auch technische Systeme, die das Engagement und die Emotionen der Studierenden messen, sind längst keine Ausnahme mehr. Sie sind zum Standard geworden und schaffen möglichst effiziente Lernumgebungen.
Es könnte sich aber auch gerade an den Universitäten Widerstand gegen solche Entwicklungen regen. Wissenschaftler:innen und Studierende stemmen sich gegen die Einschränkungen. Sie kämpfen für das Recht auf mentale Integrität und Privatsphäre und leben diese Werte auf dem Campus.
Szenario 4: Campus für Gerechtigkeit
Der Wohlstand ist extrem ungleich verteilt, die Diskrepanz zwischen armer Bevölkerung und reichen Menschen enorm. Die Kluft besteht nicht nur zwischen dem globalen Norden und Süden, sondern auch innerhalb der Bevölkerung einzelner Länder. Dies führt zu permanenten Unruhen und akuten gesellschaftlichen Spaltungen. Das industrielle Wirtschaftssystem ist zusammengebrochen und die Demokratien stehen unter radikalem Druck, neue wirtschaftliche, soziale und Governance-Modelle zu entwickeln. Eine sich wandelnde politische Landschaft treibt die Implementierung neuer Modelle für Infrastrukturen und Bildungssystemen voran.
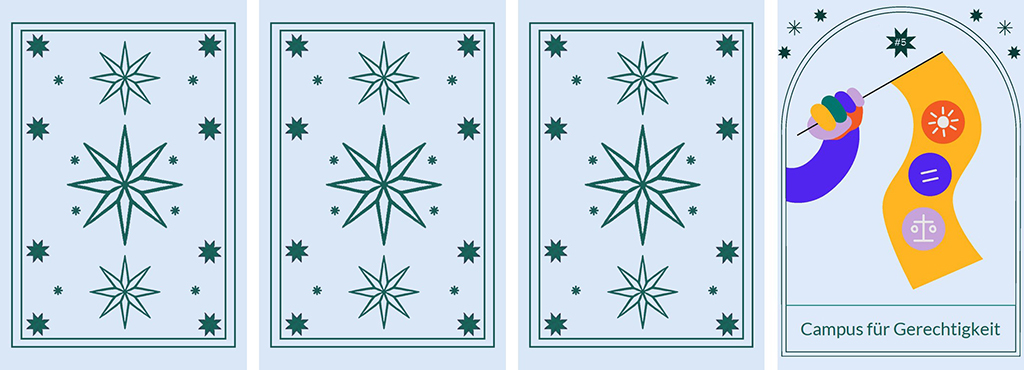
Klingt unwahrscheinlich?
Bereits jetzt besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung so viel wie die ärmere Hälfte zusammen (Turulski, 2024). Die Zahl der Milliardäre steigt wöchentlich, das Vermögen eines Milliardärs vergrößert sich dabei täglich um rund 2 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung (44%) unterhalb der Armutsgrenze von 6,85 US-Dollar täglich (Oxfam, 2025). Der aktuelle Oxfam-Bericht (2025) verweist darauf, dass Superreiche bereits 2024 über Finanzierung von Parteien, Marktmacht und Lobbyarbeit unverhältnismäßig hohen Einfluss auf die Politik nahmen und soziale Gerechtigkeit und sozialen Frieden bedrohten.
Und die Universitäten?
Für dieses Szenario zeichnen Bayne & Ross (2024) eine positive Vision der Universitäten. Studierende und Forschende spielen als Vordenker von Aktivistengruppen eine zentrale Rolle einer politischen Gegenbewegung für soziale Gerechtigkeit. Sie werfen Fragen der Ziele nach Hochschulbildung neu auf und treiben offenes Lernen voran. Alternative Formen des Wissensaustausches und der Generierung von Wissen jenseits der formalen Bildung werden etabliert. Traditionelle disziplinäre Grenzen werden aufgebrochen, Inklusion, De-Kolonialisierung und ethische Fragen prägen die Curricula.
Ausblick
Natürlich sind Prognosen schwierig. Dennoch regen möglicherweise gerade die gegenwärtigen Umbrüche und Unsicherheiten an, um mit Ideen zur Zukunft zu spielen. Unser Vorschlag: Lassen Sie sich von den Visionen von Siân Bayne und Jen Ross inspirieren. Wagen Sie – gemeinsam mit Kolleg:innen und/oder Studierenden – einen Blick in die Glaskugel und tauschen Sie sich aus, wie Hochschullehre in der Zukunft aussehen könnte. Für Ihre Gedankenspiele stehen Ihnen umfangreiche Materialien zur Verfügung, die das Team um Siân Bayne im Rahmen des Projekts “Higher Education Futures” erstellt hat.
Literatur
Bayne, S. & Ross, J. (2024). Speculative futures for higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21(1), 39. https://doi.org/10.1186/s41239-024-00469-y
Bayne, S. (2024, 13. November). Higher education and its (speculative) futures [Vortrag]. HFDcon 2024, Berlin, Deutschland.
Corporate Europe Observatory (2023). Lobbying power of Amazon, Google and Co. continues to grow. https://corporateeurope.org/en/2023/09/lobbying-power-amazon-google-and-co-continues-grow
Christen M., Mader C., Ǖas J., Abou-Chadi T., Bernstein A., Braun Binder N., Dell’Aglio D., Fábián L., George D., Gohdes A., Hilty L., Kneer M., Krieger-Lamina J., Licht H., Scherer A., Som C., Sutter P. & Thouvenin F. (2020). Wenn Algorithmen für uns entscheiden: Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. In TA-SWISS Publikationsreihe (Hrsg.): TA 72/2020. Zürich: vdf. DOI 10.3218/4002-9
de Witt, C., Rampelt, F. & Pinkwart, N. (Hrsg.) (2020). Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Whitepaper. Berlin: KI-Campus. DOI: 10.5281/zenodo.406372.
IPCC (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.
Turulski, A.-S (2024). Reichtumspyramide: Verteilung des Reichtums auf der Welt 2022. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/384680/umfrage/verteilung-des-reichtums-auf-der-welt
von Garrel, J. Mayer, J. & Mühlfeld, M. (2023). Künstliche Intelligenz im Studium. Eine quantitative Befragung von Studierenden zur Nutzung von ChatGPT & Co. DOI: 10.48444/h_docs-pub-395.
Oxfam (2025). Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen. https://www.oxfam.de/system/files/documents/oxfam-factsheet-davos-2025-milliardaersmacht-beschraenken-demokratie-schuetzen.pdf
Statista Research Department (2025). Organisationen mit den höchsten jährlichen Ausgaben für Lobbyarbeit in der EU. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1280599/umfrage/lobbyismus-ausgaben-von-organisationen-in-der-eu
Vorschlag zur Zitation des Blogbeitrags
Bachmaier, R. & Hawelka, B. (2025, 13. Februar). Universitäten zwischen Überwachung und Gerechtigkeit. 4 Visionen einer zukünftigen Hochschulbildung. Lehrblick – ZHW Uni Regensburg. https://doi.org/10.5283/ZHW.20250213.DE

Regine Bachmaier
Dr. Regine Bachmaier ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. Sie unterstützt die Lehrenden im Bereich "Digitale Lehre", u.a. durch Workshops sowie individuelle Beratung. Daneben versucht sie, den Überblick über Aktuelles aus dem Bereich "Digitale Lehre" zu behalten und weiterzugeben.
-
Regine Bachmaier
-
Regine Bachmaier

Birgit Hawelka
Dr. Birgit Hawelka ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik an der Universität Regensburg. In Forschung und Lehre beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern Lehrqualität und Evaluation. Ansonsten verfolgt sie neugierig alle Entwicklungen und Erkenntnisse rund um das Thema Hochschullehre.
-
Birgit Hawelka
-
Birgit Hawelka