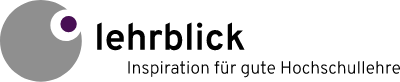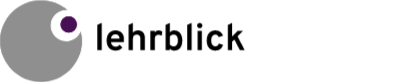Hochschulen sind zentrale Akteure im gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die heutigen Studierenden sind die Entscheidungsträger:innen von morgen und werden als Multiplikator:innen für nachhaltiges Denken und Handeln in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen agieren. Dementsprechend findet sich in vielen Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und Ländern auch die Verankerung des Themas Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Lehre.
BNE ist ein Bildungskonzept, das darauf abzielt, Menschen zu befähigen, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken (Holst & Singer-Brodowski, 2022). Es verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Dimensionen sowie deren Wechselwirkungen berücksichtigt und in einen globalen Kontext stellt (Rieckmann, 2018). Eine komplexe Thematik, bei der sich viele Lehrende fragen: Wie lässt sich das in die Lehre integrieren?
Nachhaltigkeit als Lernziel?
In Hinblick auf die Frage, wie Bildung zu nachhaltiger Entwicklung beitragen kann, wird von zwei komplementären Ansätzen ausgegangen (Vare & Scott, 2007; Wals, 2011). Beim ersten Ansatz (BNE I) handelt es sich um eine instrumentelle Betrachtungsweise. BNE I zielt darauf ab, konkrete nachhaltige Verhaltensweisen zu vermitteln und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Das bedeutet, dass es eine Grundannahme bzw. ein Expert:innenwissen gibt, welche Handlungen mit nachhaltiger Entwicklung in Verbindung stehen (Wals, 2011). Der Fokus liegt dabei auf der Frage, was konkret getan werden kann oder muss, um einen spezifischen Bereich nachhaltiger zu gestalten (Vare & Scott, 2007), und kann dementsprechend als thematischer Zugang zum Thema Nachhaltigkeit gesehen werden (Dilger & Siegel, 2023).
Viele Lehrende stehen dennoch vor der Herausforderung, dass sich nicht alle Inhalte ihrer Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in Bezug setzen lassen. Zudem stellt sich die Frage, ob es ausreicht, Studierende lediglich über Sachverhalte und Handlungsoptionen zu informieren – oder ob es nicht vielmehr darum gehen sollte, sie zu befähigen, selbst aktive Gestalter:innen einer nachhaltigen Zukunft zu werden. Fähigkeiten, wie kritisch über Nachhaltigkeit nachzudenken, Zielkonflikte zu erkennen und aktiv an der Gestaltung von Transformationsprozessen mitzuwirken, sollten demzufolge gefördert werden (Rieckmann, 2018).

Um dieser Herausforderung zu begegnen, rückt ein erweitertes Verständnis von Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Fokus, das über reine Wissensvermittlung hinausgeht und die aktive Rolle der Lernenden betont (BNE II). Nachhaltige Entwicklung wird dabei als offener Lernprozess verstanden, der sich an veränderte Bedingungen anpassen kann (Wals, 2011). Hier steht vor allem die Frage, warum wir etwas tun sollten und wie wir über Nachhaltigkeit nachdenken, im Mittelpunkt (Vare & Scott, 2007).
Um BNE II in Lernprozesse zu integrieren, eignen sich besonders aktivierende Methoden der Kompetenzförderung (Dilger & Siegel, 2023). Schlüsselkompetenzen, die angestrebt werden, sind unter anderem kritisches, systemisches und zukunftsorientiertes Denken sowie Problemlösekompetenz und Handlungskompetenz (Brundiers et al., 2021; Rieckmann, 2018). Diese Kompetenzen sind von Bedeutung, da sie sich implizit auf die Fähigkeit zur Anpassung und Innovation auswirken (Vare & Scott, 2007). Studierende lernen so nicht nur, was aktuell als „nachhaltig“ gilt, sondern, wie sie selbst, in einer sich rapide verändernden Welt, neue nachhaltige Lösungen entwickeln können.
Hochschulen sind in besonderem Maße Orte, an denen kritische Reflexionsfähigkeit und aktive Gestaltungskompetenz in den Vordergrund treten. Eine ganzheitliche Umsetzung von BNE, die inhaltliche Schwerpunkte mit einer gezielten Förderung entsprechender Kompetenzen verknüpft (Singer-Brodowski & Kminek, 2023), ist daher gerade in diesem Kontext erforderlich.
Praxisbeispiel Zusatzstudium “Nachhaltigkeit gestalten”
Prof. Dr. Mandy Singer-Brodowski, Dr. Ulrike Brok & Prof. Dr. Andreas Roider
Mit dem Zusatzstudium „Nachhaltigkeit gestalten“ schafft die Universität Regensburg ein Lehrangebot, in dem Studierende sich mit den großen Herausforderungen der Nachhaltigkeit, wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und globale Ungleichheit auseinandersetzen können. Sie lernen dabei, dass sie selbst Teil der Lösung sein können.
Das Zusatzstudium richtet sich an Studierende aller Fakultäten der Universität Regensburg. Seine Konzeption ist an den international einschlägigen Modellen für Schlüsselkompetenzen für Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung (Brundiers et al., 2021) sowie an dem Bayernzertifikat des Zentrums Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern (BayZeN) orientiert. Demnach soll das Zusatzstudium systemisches Denken, die Kompetenz, verschiedene Zukünfte zu antizipieren, den Umgang mit Normen und Werten, strategisches Handeln, Kooperationsfähigkeit sowie Selbstregulationskompetenz fördern.
In einem Basismodul lernen Studierende zunächst die grundlegenden Konzepte von Nachhaltigkeit, nachhaltiger Entwicklung und sozial-ökologischer Transformation kennen. Anschließend erhalten sie in einem Aufbaumodul die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsfragen in ihrer jeweiligen Disziplin zu vertiefen. Hier können sie sich auch nachhaltigkeitsbezogene Veranstaltungen aus ihren jeweiligen Fächern anrechnen lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, über die Grenzen des eigenen Faches Nachhaltigkeitsthemen aus Perspektive anderer Disziplinen zu erfahren. Schließlich können die Studierenden in einem Projektmodul konkrete forschungs- oder praxisbasierte Projekte eigenständig realisieren.
Über die verschiedenen Module hinweg sollen die Studierenden im Sinne einer kritisch-emanzipatorischen Bildung für nachhaltige Entwicklung (Pettig & Singer-Brodowski, 2025) ihr kritisches Denken schulen und ihre Fähigkeiten erweitern, Transformationsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit in den verschiedenen Handlungsfeldern mitzugestalten. Unabhängig davon, ob die Studierenden später in Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Administration oder Bildungspraxis beschäftigt sind, lernen sie Strategien kennen, die sie befähigen, selbst Veränderungsprozesse zu initiieren und zu begleiten. Dabei werden von Anfang an lokale Akteure des Wandels zu Wort kommen, die beispielhaft zeigen, wie gesellschaftliche Anforderungen der Transformation für Nachhaltigkeit vor Ort in Organisationen und Netzwerken übersetzt und realisiert werden. Diese Akteure des Wandels können auch Praxispartner für die studentischen Projekte sein.
Um die Qualität des Zusatzstudiums „Nachhaltigkeit gestalten“ von Beginn an stetig zu verbessern, wird eine formative Evaluation durchgeführt. Neben der studentischen Kompetenzentwicklung (Bremer et al., 2024) werden hier die Entwicklung des nachhaltigkeitsbezogenen Wissens, die Einstellungen sowie die nachhaltigkeitsbezogenen Emotionen und nicht zuletzt die individuelle und kollektive Selbstwirksamkeit erfasst. Der Vergleich der Studierendenkohorte mit einer Kontrollgruppe zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten (Längsschnitt) ermöglicht Rückschlüsse auf die Effekte des Zusatzstudiums. Erste Ergebnisse werden im Sommer 2026 erwartet.
Und wenn Dozierende das Thema BNE in ihre eigene Lehre einfließen lassen möchten?
Viele Dozierende lernen in ihrem Studium und der akademischen Laufbahn nichts über BNE. Soll Nachhaltigkeitsbildung an Hochschulen künftig stärker verankert werden, ist es daher entscheidend, nicht nur Studierende, sondern auch Lehrende in diesem Bereich zu qualifizieren. Ein gelungenes Beispiel für ein entsprechendes Weiterbildungsangebot wurde an der Universität St. Gallen entwickelt: Dr. Stefan Siegel und Kolleg:innen konzipierten den Selbstlernkurs „Sustainability Education 101“. Dieser Kurs vermittelt grundlegende Kenntnisse, die einen niederschwelligen Einstieg in das Thema ermöglichen. Darüber hinaus kann im Rahmen des Kurses ein Lehrkonzept entwickelt werden, das die spezifischen Gegebenheiten der eigenen Lehrveranstaltung berücksichtigt. Im Wintersemester 25/26 wird der Kurs auch am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg angeboten.
Neben dem Besuch von Workshops oder Kursen stehen Dozierenden weitere Möglichkeiten offen, sich in das Thema einzuarbeiten. Zum Beispiel bietet die Plattform DG HochN vielfältige Inspirationen für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen. Sie stellt einen Überblick zum Thema BNE bereit und präsentiert zusätzlich Praxisbeispiele für die Lehre. Verschiedene Projekte werden ebenfalls vorgestellt. Dadurch können auch Einsteiger:innen Elemente der BNE in ihre Lehre integrieren.
Wie der Kompetenzerwerb im Sinne von BNE in einer Lehrveranstaltung umgesetzt werden kann, zeigt auch die Ruhr-Universität Bochum. Dort wird im Masterstudiengang Geographie die Veranstaltung „Umweltverträglichkeitsstudie im Straßenbau“ angeboten. Die Studierenden lernen Methoden der ökologischen Raumanalyse und -bewertung sowie der planerischen Modellierung kennen. An diesen Themen arbeiten die Studierenden in Projektgruppen. So erwerben sie neben fachspezifischem Wissen und Fähigkeiten ebenfalls soziale Kompetenzen, die in die Bewertung ihrer Leistung mit einfließen. Mit diesem Vorgehen werden fachliches Wissen (BNE I), fachspezifische Kompetenzen wie z.B. Gestaltungskompetenz (BNE II) ebenso wie interpersonale Kompetenzen (BNE II) gleichermaßen gefördert und miteinander vereint.
Fazit
DIE nachhaltige Bildung gibt es nicht (Singer-Brodowski & Kminek, 2023). Nachhaltigkeit sollte nicht als starres Regelwerk verstanden werden, sondern als dynamischer Lernprozess, in dem Studierende selbst Lösungen für eine nachhaltige Zukunft entwickeln. Dafür brauchen sie Wissen, aber auch Kompetenzen. Hochschulen tragen eine besondere Verantwortung, Studierende zu befähigen, sich diese Kompetenzen aktiv zu erarbeiten. Innovative Lehrangebote setzen genau hier an: Sie bieten Studierenden aller Fachrichtungen die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsthemen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und sich aktiv in Transformationsprozesse einzubringen.
Literatur
Bremer, A., Lindau, A., & Brok, U. (2024). Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenzen bei Studierenden im Service Learning – ein Erhebungsinstrument zur Selbsteinschätzung. ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 47(4), 10–14. https://doi.org/10.31244/zep.2024.04.03
Brundiers, K., Barth, M., Cebrián, G., Cohen, M., Diaz, L., Doucette-Remington, S., Dripps, W., Habron, G., Harré, N., Jarchow, M., Losch, K., Michel, J., Mochizuki, Y., Rieckmann, M., Parnell, R., Walker, P., & Zint, M. (2021). Key competencies in sustainability in higher education—toward an agreed-upon reference framework. Sustainability Science, 16(1), 13–29. https://doi.org/10.1007/s11625-020-00838-2
Dilger, B., & Siegel, S. T. (2023). Sustainability Education in Forschung und Lehre am Institut für Wirtschaftspädagogik. HSG Focus. https://hsgfocus.unisg.ch/1-2023-deglobalisierung/artikel/forschung-sustainbility-education-in-forschung-und-lehre-am-institut-fuer-wirtschaftspaedagogik
Holst, J., & Singer-Brodowski, M. (2022). Nachhaltigkeit & BNE im Hochschulsystem: Stärkung in Gesetzen und Zielvereinbarungen, ungenutzte Potentiale bei Curricula und der Selbstverwaltung. Kurzbericht des Nationalen Monitorings zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Institut Futur, Freie Universität Berlin. http://dx.doi.org/10.17169/refubium-35828
Pettig, F., & Singer-Brodowski, M. (2025). Learning in relation to a changing world. Thinking beyond ESD1 and ESD2 towards ESD3. Journal of Education for Sustainable Development. https://doi.org/10.1177/09734082251347383
Rieckmann, M. (2018). Die Bedeutung von Bildung für nachhaltige Entwicklung für das Erreichen der Sustainable Development Goals (SDGs). ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 41(2), 4–10. https://doi.org/10.25656/01:18955
Singer-Brodowski, M., & Kminek, H. (2023). Zu den Zielen von Bildung für nachhaltige Entwicklung und dem Stand der Implementierung im deutschen Schulsystem. DDS, 115(2), 94–104. https://doi.org/10.31244/dds.2023.02.03
Vare, P., & Scott, W. (2007). Learning for a change: Exploring the relationship between education and sustainable development. Journal of Education for Sustainable Development, 1(2), 191–198. https://doi.org/10.1177/097340820700100209
Wals, A. E. J. (2011). Learning our way to sustainability. Journal of Education for Sustainable Development, 5(2), 177–186. https://doi.org/10.1177/097340821100500208
Vorschlag zur Zitation
Hrabetz, B., & Puppe, L. (2025, 17. Juli). Lernen als nachhaltige Entwicklung: Warum Hochschulen mehr als nur Wissen vermitteln müssen. Lehrblick – ZHW Uni Regensburg. https://doi.org/10.5283/ZHW.20250717.DE

Barbara Hrabetz
Barbara Hrabetz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Erziehungswissenschaft an der Universität Regensburg und im Projekt Selvi@ur am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik. Sie promoviert zu sozialen Einflussfaktoren auf nachhaltiges Handeln. Ein weiteres ihrer Interessensgebiete ist Bildung in der Migrationsgesellschaft.
-
Dieser Autor hat keine weiteren Beiträge verfasst.

Linda Puppe
Dr. Linda Puppe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik an der Universität Regensburg. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern innovative Lehre und Motivation. Zudem interessiert sie sich für Entwicklungen im Bereich digitale Lernumgebungen.